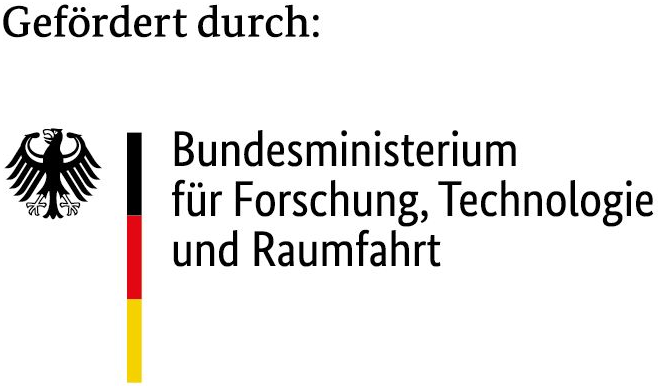Wirkungen und Zukunftsperspektiven des Modellprojektes "Wir bündeln Bio"
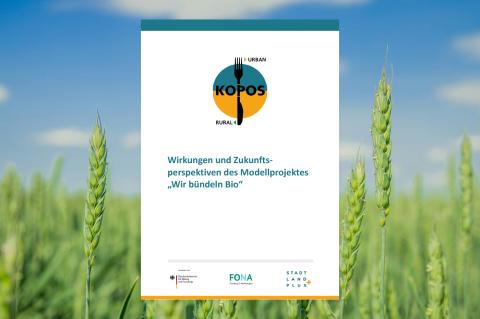
Wirkungsanalyse des KOPOS-Projekts für Freiburg
Das Modellprojekt und Nachhaltigkeitsexperiment "Wir bündeln Bio" (WbB) hatte das Ziel, bio-regionale Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette zu bündeln und effizienter zu vermarkten. Im Fokus stand dabei die Zusammenarbeit zwischen regional ansässigen Produzenten von Lebensmitteln, Groß- und Einzelhändlern sowie der Außer-Haus-Verpflegung (AHV). Dieser Bericht fasst die wesentlichen Ergebnisse, Wirkungen und Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung des Projekts zusammen.
Das Projekt WbB hat wertvolle Impulse zur Stärkung der bio-regionalen Wertschöpfungskette gesetzt und durch die Etablierung und dem Testen physischer Strukturen am Großmarkt Freiburg eine Vielzahl unterschiedlicher Wirkungen entlang der untersuchten Wertschöpfungskette entfaltet, die jedoch hinsichtlich ihrer langfristigen Wirkungskraft infrage gestellt werden müssen. Die auf eine befristete Dauer angelegte Förderung des Modellprojektes „Wir bündeln Bio“ könnte sich als zu kurzfristig herausstellen, da die Akteure in der Wertschöpfungskette (vor allem die Produzenten) langfristige Planungshorizonte benötigen. Die Weiterführung des Projekts benötigt gezielte Anpassungen, insbesondere im Bereich der Logistik und Preisgestaltung. Die Zusammenarbeit mit engagierten Händlern sowie eine verstärkte Digitalisierung der Bestellprozesse könnten zur Verstetigung des Projekts beitragen. Langfristig könnte auch die Entwicklung von Produzenten-Konsumenten-Kooperationen eine Möglichkeit sein, um die Planbarkeit und Verbindlichkeit in der Beschaffung zu verbessern.
Aus der Vielfalt beobachteter Wirkungen des Projekts WbB sind folgende besonders prominent:
- Inbetriebnahme eines Warenumschlagspunkts,
- Aktivierung und Sensibilisierung regionaler Akteure,
- Wirkungen auf unterschiedliche Akteursgruppen (z. B. Produzenten, AHV-Kunden, Händler am Großmarkt).
Das Projekt WbB hat hinsichtlich der materiell-physischen Ebene sowie der kulturell-symbolischen Ebene die meisten Wirkungen erzielt. Dies macht sich an den etablierten Warenströmen und der in Betrieb genommenen Infrastruktur am Großmarkt Freiburg fest. Das Nachhaltigkeitsexperiment konnte in das komplexe und stark regulierte System des Lebensmittelhandels integriert werden und Waren und Geldströme erzeugen. Auf der kulturell-symbolischen Ebene hat das Projekt es vermocht, einer Fachöffentlichkeit in der Region aufzuzeigen, dass Strukturen nachhaltigerer Ernährungsysteme in den etablierten Strukturen gegenwärtig unterrepräsentiert sind, aber dass es möglich ist, entsprechende Strukturen aufzubauen. Somit wirkte die materiell-physische Ebene zusammen mit einer Vielzahl an interaktiven Formaten vor Ort vermutlich stark auf die kulturell-symbolische Ebene ein. Das Projekt hat durch sein Wirken dazu beigetragen, die Bedeutung einer etablierten Infrastruktur, deren Fortbestehen unter den aktuellen Marktbedingungen anzuzweifeln ist, hervorzuheben und mit zukunftsgerichteten Themen zu besetzen. Der Großmarkt Freiburg hat das Potenzial eine Schlüsselrolle als Kristallisationspunkt der Ernährungswende in der Region zu spielen, indem er sich strategisch neu aufstellt.
Ob diese Wirkungszusammenhänge auch auf andere Dimensionen einzahlen, bleibt abzuwarten. Nach den Ergebnissen dieser Wirkungserhebung hat das Projekt kaum dazu beitragen können, auf regulativ-institutionalisierter Ebene (also der Veränderungen von Normen und Gesetzen) sowie auf einer handlungsbezogenen-prozeduralen (insb. hinsichtlich der Veränderungen von Praktiken in Richtung Nachhaltigkeit) bedeutende Wirkungen zu erzielen. AHV-Kunden und Produzenten, die mit WbB zusammengearbeitet haben, haben bereits zuvor mit biologischen und zum Teil regionalen Lebensmitteln gehandelt und WbB als einen zusätzlichen Kanal benutzt, ohne etablierte Strukturen aufzugeben.
Das Projektteam um WbB hat es in einer eineinhalbjährigen Zeitspanne geschafft, die Struktur handlungsfähig zu machen und zu bespielen, was auch durch die Budgetierung als KOPOS-Modellprojekt sowie durch den Einsatzes von Personalkapazitäten aus dem KOPOS-Projekt ermöglicht wurde. Hinsichtlich der beobachteten Wirkungen lassen sich folgende Erkenntnisse für eine Transformation von Ernährungsystemen ableiten:
- Warenpreise und Aufwand sind starke Wirkungshebel in den Wertschöpfungsketten.
- Handelsbeziehungen zwischen den Akteuren beruhen auf Vertrauen.
- Das Verharrungsvermögen der Akteure entlang der Wertschöpfungskette ist unterschiedlich ausgeprägt.
- Der Gegensatz zwischen "konventionell" und "bio" ist real und erschwert eine Integration auf „regional“.
- Wirkungen im Kleinen sind nicht von Makroentwicklungen losgelöst zu betrachten.